Was ist eine Business-Impact-Analyse (BIA)?
Was ist eine Business-Impact-Analyse (BIA)? Der EBA Leitfaden EBA/GL/2019/04 gibt Leitlinien für das Management von IKT- und Sicherheitsrisiken. Bei der Business Impact Analyse werden schwerwiegende Betriebsunterbrechungen analysiert und deren potenzielle Auswirkungen (einschließlich der Auswirkung auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit) quantitativ und qualitativ bewertet.
Dabei sollen sie interne und/ oder externe Daten (z.B. für den Geschäftsprozess relevante Daten von Drittanbietern oder öffentlich verfügbare Daten, die für die BIA relevant sein können) und Szenarioanalysen verwenden.
Durch die BIA soll auch die Kritikalität der festgestellten und klassifizierten Geschäftsfunktionen, der Unterstützungsprozesse, von Dritten und der IT-Assets sowie deren Abhängigkeiten berücksichtigt werden.
Die IKT-Systeme und IKT-Dienste sollen so konzipiert und auf Ihre BIA abgestimmt sein, dass diese beispielweise bestimmte kritische Komponenten redundant ausgelegt sind, um Störungen durch Ereignisse mit Auswirkungen auf die Bestandteile zu verhindern.
Das Seminar Was ist eine Business-Impact-Analyse (BIA)? online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. A04.
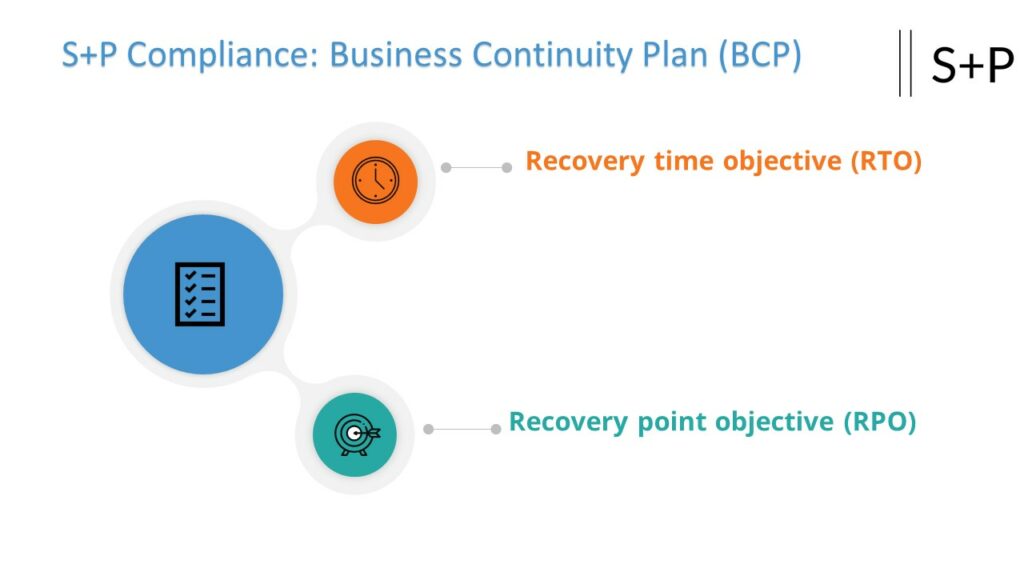
Zielgruppe zum Seminar Was ist eine Business-Impact-Analyse (BIA)?
- Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Kapitalanlage- und Fondsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
- Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Notfallmanagement, Auslagerungsmanagement, IT-Compliance, Compliance Beauftragte und Interne Revision.
Dein Nutzen mit dem Seminar Was ist eine Business-Impact-Analyse (BIA)?
#1 Aufgaben und Pflichten des Business Continuity Managers
#2 Business Impact Analysen und Risk Impact Analysen
#3 Laufende Überwachungspflichten des Business Continuity Managers
Dein Vorsprung mit dem Seminar Was ist eine Business-Impact-Analyse (BIA)?
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die S+P Tool Box:
+ Leitfaden für BCM (ca. 30 Seiten)
+ Muster-Reporting für Business Continuity Manager
+ S+P Tool Risk Impact Analyse für mehr Prüfungssicherheit
#1 Aufgaben und Pflichten des Business Continuity Managers
MaRisk AT 7.3: Das deutlich erweiterte Aufgabenspektrum des BCM:
o Ziele zum Notfallmanagement und Ableitung eines Notfallmanagementprozess
o Notfallkonzept für zeitkritische Aktivitäten und Prozesse
o Festlegen von geeigneten Maßnahmen zur Schadensreduzierung
Neue Reporting-Pflichten: mindestens quartalsweise Berichterstattung über den Zustand des Notfallmanagements
Notfallkonzept mit Geschäftsfortführungs- sowie Wiederherstellungsplänen
Schnittstelle Auslagerung: Outsourcer und Insourcer müssen über aufeinander abgestimmte Notfallkonzepte verfügen.
#2 Business Impact Analysen und Risk Impact Analysen
Verschärfte Anforderungen an Business Impact Analysen:
o Beeinträchtigung von Aktivitäten und Prozessen
o Art und Umfang des (im-)materiellen Schadens
o Zeitpunkt des Ausfalls.
Risk Impact Analysen für die identifizierten zeitkritischen Aktivitäten und Prozesse:
o Identifizieren und Bewerten von potentiellen Gefährdungen
o Durchführung der qualitativ verschärften Risikoanalyse auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien
Berücksichtigung von Notfallszenarien
o (Teil-)Ausfall eines Standortes (z. B. durch Hochwasser, Großbrand, Gebietssperrung, Ausfall der Zutrittskontrolle)
o Erheblicher Ausfall von IT-Systemen oder Kommunikationsinfrastruktur
o Ausfall einer kritischen Anzahl von Mitarbeitern
o Ausfall von Dienstleistern (z. B. Zulieferer, Stromversorger)
#3 Laufende Überwachungspflichten des Business Continuity Managers
MaRisk + BAIT: Anforderungen an Monitoring- und Kontrollhandlungen
Maßstäbe für Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten und deren Durchführung
Prüfungssichere Bewertung der Auswirkungs- und Risikoanalysen
o Wirksamkeit und Angemessenheit des Notfallkonzeptes ist regelmäßig zu überprüfen.
o Für zeitkritische Aktivitäten und Prozesse sind die relevanten Szenarien mindestens jährlich und anlassbezogen nachzuweisen.
Überprüfungen des Notfallkonzeptes sind zu protokollieren.
o Ergebnisse sind hinsichtlich notwendiger Verbesserungen zu analysieren.
o Die Ergebnisse sind den jeweiligen Verantwortlichen schriftlich mitzuteilen.
Das Seminar Was ist eine Business-Impact-Analyse (BIA)? online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. A04.
Das könnte dich als Business Continuity Manager auch interessieren
MaRisk 6.0: Verschärfte Anforderungen an das Notfallmanagement. Aus den ICT Guidelines werden Anforderungen zum Notfallmanagement im neu gefassten Abschnitt AT 7.3 umgesetzt.
Für alle im Rahmen einer durchzuführenden Auswirkungsanalyse identifizierten zeitkritischen Aktivitäten und Prozesse sind zunächst Risikoanalysen durchzuführen. Im Notfallkonzept muss dargestellt sein, welche Ersatzlösungen im Notfall zeitnah zur Verfügung stehen und wie eine Rückkehr zum Normalbetrieb verlaufen soll.
Als Basis hierfür dient eine Übersicht über alle Aktivitäten und Prozesse (z. B. in Form einer Prozesslandkarte). Die Wirksamkeit und Angemessenheit des Notfallkonzeptes ist regelmäßig zu überprüfen.
#1 MaRisk 6.0: Verschärfte Anforderungen an das Notfallmanagement
Das Kapitel AT 7.3 Notfallmanagement wurde nun wie folgt gefasst:
- Das Institut hat Ziele zum Notfallmanagement zu definieren und hieraus abgeleitet einen Notfallmanagementprozess festzulegen. Für Notfälle in zeitkritischen Aktivitäten und Prozessen ist Vorsorge zu treffen (Notfallkonzept). Die im Notfallkonzept festgelegten Maßnahmen müssen dazu geeignet sein, das Ausmaß möglicher Schäden zu reduzieren. Das Notfallkonzept ist anlassbezogen zu aktualisieren, jährlich auf Aktualität zu überprüfen und angemessen zu kommunizieren. Die Geschäftsleitung hat sich mindestens quartalsweise und anlassbezogen über den Zustand des Notfallmanagements schriftlich berichten zu lassen.
- Das Notfallkonzept muss Geschäftsfortführungs- sowie Wiederherstellungspläne umfassen. Geschäftsfortführungspläne müssen gewährleisten, dass im Notfall zeitnah Ersatzlösungen zur Verfügung stehen. Wiederherstellungspläne müssen innerhalb eines angemessenen Zeitraums die Rückkehr zum Normalbetrieb ermöglichen. Bei Notfällen ist eine angemessene interne und externe Kommunikation sicherzustellen. Im Fall der Auslagerung von zeitkritischen Aktivitäten und Prozessen haben das auslagernde Institut und das Auslagerungsunternehmen über aufeinander abgestimmte Notfallkonzepte zu verfügen.
- Die Wirksamkeit und Angemessenheit des Notfallkonzeptes ist regelmäßig zu überprüfen. Für zeitkritische Aktivitäten und Prozesse ist sie für alle relevanten Szenarien mindestens jährlich und anlassbezogen nachzuweisen. Überprüfungen des Notfallkonzeptes sind zu protokollieren. Ergebnisse sind hinsichtlich notwendiger Verbesserungen zu analysieren. Risiken sind angemessen zu steuern. Die Ergebnisse sind den jeweiligen Verantwortlichen schriftlich mitzuteilen.
Die MaRisk geben zu den verschärften Anforderungen an das Notfallmanagement folgende Erläuterungen.
#2 Zeitkritische Aktivitäten und Prozesse
Zeitkritisch sind grundsätzlich jene Aktivitäten und Prozesse, bei deren Beeinträchtigung für definierte Zeiträume ein nicht mehr akzeptabler Schaden für das Institut zu erwarten ist.
Zur Identifikation von zeitkritischen Aktivitäten und Prozessen sowie von unterstützenden Aktivitäten und Prozessen, hierfür notwendigen IT-Systemen und sonstigen notwendigen Ressourcen sowie den potentiellen Gefährdungen führt das Institut Auswirkungsanalysen und Risikoanalysen durch. Als Basis hierfür dient eine Übersicht über alle Aktivitäten und Prozesse (z. B. in Form einer Prozesslandkarte).
#3 Auswirkungsanalysen – MaRisk 6.0: Verschärfte Anforderungen an das Notfallmanagement
In Auswirkungsanalysen (Business Impact Analysen) wird über abgestufte Zeiträume betrachtet, welche Folgen eine Beeinträchtigung von Aktivitäten und Prozessen für den Geschäftsbetrieb haben kann. Die Auswirkungsanalysen sollten u. a. folgende Aspekte berücksichtigen:
– Art und Umfang des (im-)materiellen Schadens
– Auswirkung des Zeitpunkts des Ausfalls auf den Schaden (z. B. Ausfall des Zahlungsverkehrs zu Hauptgeschäftszeiten)
#4 Risikoanalysen – Business Continuity Manager: Aufgaben und Pflichten
In Risikoanalysen (Risk Impact Analysen) für die identifizierten zeitkritischen Aktivitäten und Prozesse werden potentielle Gefährdungen identifiziert und bewertet, welche eine Beeinträchtigung der zeitkritischen Geschäftsprozesse verursachen können.
#5 Notfallkonzept – Aufgaben und Pflichten des Business Continuity Managers
Im Notfallkonzept werden Verantwortlichkeiten, Ziele und Maßnahmen zur Fortführung bzw. Wiederherstellung von zeitkritischen Aktivitäten und Prozessen bestimmt und Kriterien für die Einstufung sowie für das Auslösen der Pläne definiert.
#6 Notfallszenarien – MaRisk 6.0: Verschärfte Anforderungen an das Notfallmanagement
Hierbei werden mindestens folgende Szenarien berücksichtigt:
– (Teil-)Ausfall eines Standortes (z. B. durch Hochwasser, Großbrand, Gebietssperrung,Ausfall der Zutrittskontrolle)
– Erheblicher Ausfall von IT-Systemen oder Kommunikationsinfrastruktur (z. B. aufgrund von Fehlern oder Angriffen)
– Ausfall einer kritischen Anzahl von Mitarbeitern (z. B. bei Pandemie, Lebensmittelvergiftung, Streik)
– Ausfall von Dienstleistern (z. B. Zulieferer, Stromversorger)
#7 Überprüfungen des Notfallkonzeptes – Aufgaben und Pflichten des Business Continuity Managers
Die Häufigkeit und der Umfang der Überprüfungen soll sich grundsätzlich an der Gefährdungslage orientieren. Dienstleister sind angemessen einzubinden. Überprüfungen beinhalten u. a.:
– Test der technischen Vorsorgemaßnahmen
– Kommunikations-, Krisenstabs- und Alarmierungsübungen
– Ernstfall- oder Vollübungen.
#8 Welche Umsetzungsfristen gelten für die Neuen MaRisk 6.0?
Die neue Fassung der MaRisk tritt mit Veröffentlichung in Kraft. Es gilt eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2021.
Dies gilt für die auf das Auslagerungsregister bezogene Dokumentationsanforderung in AT 9 Tz. 14 MaRisk nur insoweit, als auch die Pflicht zum Vorhalten eines Auslagerungsregisters mit dem Inkrafttreten des FISG bereits zum 01.01.2022 gilt.
Andernfalls richtet sich der erstmalige Geltungstag auch für die Konkretisierung dieser Anforderung in den MaRisk nach dem Gesetz.
Davon abweichende Umsetzungsfristen ergeben sich für die Anpassung von bereits bestehenden oder in Verhandlung befindlichen Auslagerungsverträgen.
Hierfür wird eine gesonderte Umsetzungsfrist bis zum 31.12.2022 eingeräumt.
Eine Anpassung von Vertragsverhältnissen, die auf der Grundlage eines öffentlichen Vergabeverfahrens abgeschlossen wurden, kann wegen der besonderen rechtlichen Probleme unterbleiben, soweit diese Verträge befristet sind und innerhalb der nächsten fünf Jahre neu vergeben werden müssen. Die BaFin geht davon aus, dass bei Vergabeverfahren, die ab dem 01.01.2022 initiiert werden, bereits die neuen Anforderungen ausreichend berücksichtigt werden.
Institute mit hohem NPL-Bestand haben die Anforderungen aus den NPE Guidelines bereits unmittelbar nach Ablauf der Übergangsfrist am 31.12.2021 einzuhalten, sofern diese Institute an den zwei vorhergehenden Quartalsstichtagen (30.09.2021 und 31.12.2021) eine NPL-Quote größer 5 % aufweisen.
Der erste, für die Einstufung als Institut mit hohem NPL-Bestand relevante Quartalsstichtag ist daher der 30.09.2021.