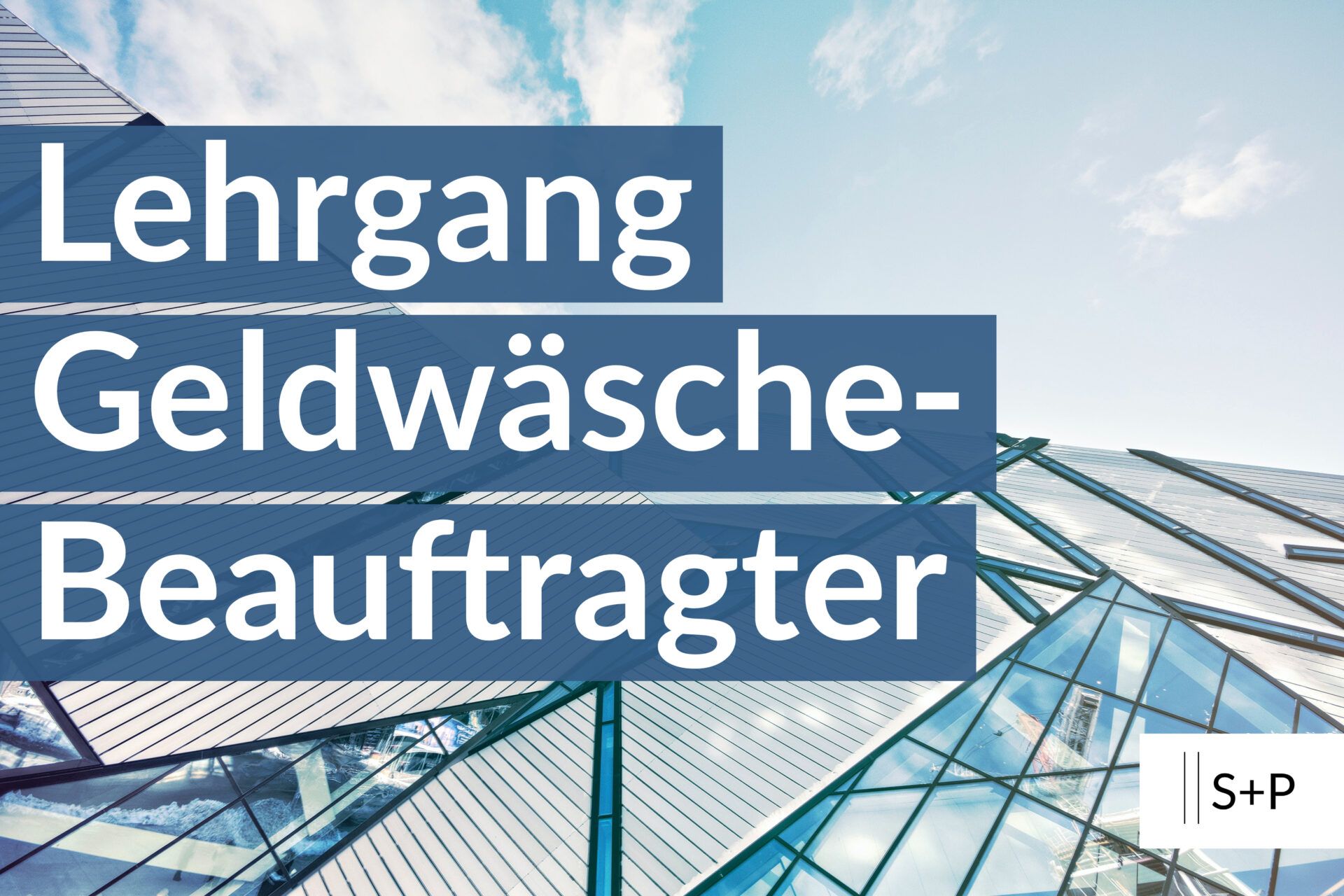Risikoanalyse nach § 5 GwG und § 25 h KWG – Was ist zu beachten?
Risikoanalyse § 5 GwG – Die Einrichtung eines angemessenen Risikomanagements nach § 5 GwG einschließlich klarer Berichtspflichten ist die Grundlage für eine effektive Risikovermeidung und -mitigation. Die Erstellung einer institutsspezifischen Risikoanalyse sowie die Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, angemessener Geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sind hierfür unerlässlich. In diesem Seminar wird das neueste Risikomanagement-Framework erläutert und du lernst, wie du Risiken effektiv bewerten und beurteilen kannst. Dabei werden auch die neuesten Erkenntnisse der Finanzaufsicht berücksichtigt.

Risikoanalyse § 5 GwG
- Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
- Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
805 €
-
Risikoanalyse nach §5 GwG
-
Embargos und Sanktionen – Neue Compliance-Pflichten
-
Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte
Risikoanalyse § 5 GwG
Programm zum Seminar Risikoanalyse § 5 GwG
09.15 bis 17.00
- Risikoanalyse § 5 GwG
- Bestandsaufnahme der unternehmensspezifischen Situation
- Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
- Sektor-spezifische Risikofaktoren zur Geldwäscheprävention
- Risikofaktoren für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen
- Erfassung und Identifizierung der Risikofaktoren
- Kundenrisiko
- Produkt-, Dienstleistungs- und Transaktionsrisiko
- Vertriebswegerisiko
- Länderrisiko
- Sonstige Risiken
- Kategorisierung und Gewichtung der Risikofaktoren
- Einteilung in Risikogruppen und
- Bewertung der identifizierten Risiken
- Entwicklung und Umsetzung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen:
- Geringes, mittleres und hohes Risiko: Was ist zu tun?
- Kontroll- und Überwachungsplan für den Geldwäsche Officer
Embargos und Sanktionen – Neue Compliance-Pflichten
- Beschränkungen im Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs
- Länder- und Personenbezogene Embargos
- Was ändert sich mit den Sanktionsdurchsetzungsgesetzen (SanktDG)?
- Neue EU Richtlinie über Vermögensabschöpfung und Beschlagnahme
- Regeln zu Erfüllungsverbot und Altvertragsklausel beachten
Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte
- Risikomanagement GW / TF: Prüfungssichere Umsetzung der EU-DSGVO
- § 11a GwG: Richtiger Umgang mit personenbezogenen Daten
- Gibt es Datenschutz-Einschränkungen bei der Identitätsprüfung?
- Gruppenweit einheitliche Sicherungsmaßnahmen für den Datenschutz
- Rechtsfolgen bei der Verletzung von Datenschutzpflichten
Mit S+P Seminare rechtssicher arbeiten!
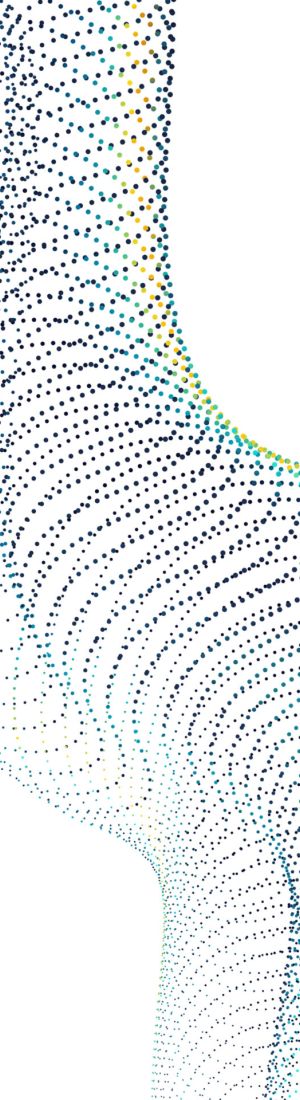
Die S+P Tool Box
- Vorträge als PDF: Für ein schnelles Nachschlagen und Auffrischen des Seminarinhalts
- Effektive Risikoanalyse nach §5 GwG: Das Toolkit zeigt dir, wie du eine gründliche Risikoanalyse durchführst, um Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken zu identifizieren und proaktiv angemessene Präventionsmaßnahmen zu ergreifen.
- Working Paper „Neue Compliance-Pflichten bei Embargos und Sanktionen“: Du erfährst, wie du die neuesten Vorgaben und Pflichten im Umgang mit Embargos und Sanktionen in deine Geldwäschepräventionsstrategie integrierst und so die Einhaltung der Compliance sicherstellst.
- Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte: Das Toolkit bietet praxisrelevante Informationen und Best Practices zum Datenschutz als Geldwäsche-Beauftragter, damit du personenbezogene Daten sicher und vertraulich handhabst und die Datenschutzvorschriften rechtskonform erfüllst.
Praxisnahes Lernen für deinen Arbeitsalltag: Erfolgreiche Beispiele, sofortige Anwendung.
Case Study 1: Effiziente Risikoanalyse für einen GwG-Verpflichteten
Du lernst in dieser Fallstudie, wie ein GwG-Verpflichteter eine umfassende Risikoanalyse gemäß §5 GwG durchgeführt hat, um potenzielle Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken zu identifizieren und erfolgreich Präventionsmaßnahmen einzuleiten.
Case Study 2: Compliance bei Embargos und Sanktionen in einem Unternehmen
In dieser Fallstudie erfährst du, wie ein Unternehmen die neuen Compliance-Pflichten bei Embargos und Sanktionen erfolgreich umgesetzt hat, um rechtliche Risiken zu minimieren und einen rechtskonformen Geschäftsbetrieb sicherzustellen.
Case Study 3: Datenschutz in der Geldwäsche-Prävention – Die richtigen Schritte für einen effektiven Schutz personenbezogener Daten
Diese Fallstudie zeigt dir, wie ein Geldwäsche-Beauftragter die Datenschutzbestimmungen umfassend eingehalten hat, um personenbezogene Daten sicher und vertraulich zu behandeln und mögliche Datenschutzverletzungen zu verhindern.
Wie du deinen Erfolg mit der S+P Tool Box steigern kannst
Unser praxisnahes Lernen ermöglicht dir eine schnelle Umsetzung des erlangten Wissens und eine deutliche Steigerung deiner Kompetenz im Bereich Geldwäscheprävention! Die S+P Tool Box bietet dir wertvolle Ressourcen für deinen beruflichen Erfolg.
Nutzen für dich als Seminarteilnehmer:
-
Zeitersparnis: Dank der Vorträge als PDF kannst du rasch relevante Informationen abrufen und effizient arbeiten.
-
Sicherheit in der Risikobewertung: Unsere gründliche Risikoanalyse hilft dir, Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken frühzeitig zu erkennen und angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
-
Compliance-Gewissheit: Mit der Integration neuer Compliance-Pflichten bei Embargos und Sanktionen bist du bestens vorbereitet und gewährleistest die Einhaltung aller Vorschriften.
-
Vertraulicher Umgang mit Daten: Unsere praxisrelevanten Informationen zum Datenschutz stärken dein Vertrauen im Umgang mit sensiblen Daten und verhindern Datenschutzverletzungen.
Mit der S+P Tool Box setzt du das erworbene Wissen schnell und kompetent in deinem Arbeitsumfeld um. Dein Erfolg ist unser Ziel!
Das könnte dich interessieren…
Eine Risikoanalyse nach § 5 GwG – Aufbau, Struktur und Inhalt.
Die Risikoanalyse ist gemäß § 5 Geldwäschegesetz ein wesentliches Instrument des Geldwäsche Beauftragten zur Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche. Dabei handelt es sich um einen Prozess, in dem die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung offengelegt, bewertet und – soweit möglich – minimiert werden.
Die Risikoanalyse nach § 5 GwG setzt sich aus fünf Schritten zusammen:
- die vollständige Bestandsaufnahme der unternehmensspezifischen Situation,
- die Erfassung und Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen sowie der
geografischen Risiken, - die Kategorisierung, d.h. Einteilung in Risikogruppen, und ggf. zusätzliche Gewichtung, d.h. Bewertung, der identifizierten Risiken,
- die Entwicklung und Umsetzung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen, die im Rahmen der erforderlichen Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen aufgrund des Ergebnisses der Risikoanalyse
verwendet werden, - die Überprüfung und Weiterentwicklung der bisher getroffenen internen Sicherungsmaßnahmen
unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Risikoanalyse.
Ziel dieser Analyse ist es, die wesentlichen Merkmale der Kunden- bzw. Geschäftsbeziehung zu ermitteln und zu bewerten. Dabei werden unter anderem folgende Fragen beantwortet:
- Woher stammt das Geld des Kunden?
- Welche Art von Geschäftsbeziehung besteht mit dem Kunden?
- Welches sind die Motive des Kunden für die Geschäftsbeziehung?
Auf Basis dieser Informationen kann der Geldwäschebeauftragte einschätzen, ob das Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hoch oder niedrig ist.
In der Transaktionsanalyse werden die einzelnen Transaktionen des Kunden auf ihre Plausibilität überprüft. Dabei wird untersucht, ob die Transaktionen mit den Angaben in der Kunden- bzw. Geschäftsbeziehungsanalyse übereinstimmen. Auch hier gilt: Je höher das Risiko, desto genauer ist die KYC-Analyse.
S+P Seminar Risikoanalyse nach § 5 GwG – Mit der S+P Tool Box wird das Arbeiten einfacher.
Aufbau und Struktur der Risikoanalyse
Die Risikoanalyse ist ein wesentliches Instrument des Geldwäschegesetzes (§ 5 GwG), um die Gefahr der Geldwäsche zu minimieren. Sie dient dazu, die Risiken für das Unternehmen bei der Durchführung von Geschäften mit Kunden einzuschätzen und diese Risiken angemessen zu berücksichtigen.
Die Risikoanalyse ist somit ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagementsystems eines Unternehmens. Inhaltlich geht es in der Risikoanalyse vor allem um die Feststellung von Schwachstellen in den internen Prozessen und Abläufen sowie um die Einschätzung der Geldwäsche- und Terrorfinanzierungsrisiken. Dabei sollten sowohl die allgemeinen Risiken als auch die spezifischen Risiken für das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit berücksichtigt werden. Folgende Risikofaktoren sind zu bewerten:
- Kundenrisiko
- Produkt-, Dienstleistungs- und Transaktionsrisiko
- Vertriebswegerisiko
- Länderrisiko
- Sonstige Risiken
Risikofaktoren erkennen und handeln – die S+P Seminare zeigen dir wie.
Risikoanalyse § 5 GwG: Embargos und Sanktionen
Was sind Embargos und Sanktionen? Nach traditionellem Verständnis sind Embargos Wirtschaftssanktionen, die gegenüber einem bestimmten Staat verhängt werden. Der Außenwirtschaftsverkehr mit diesen Staaten wird nach Maßgabe des entsprechenden Embargos eingeschränkt oder sogar komplett untersagt.
Ein typisches Beispiel für ein Embargo ist das Verbot, Rüstungsgüter in einen bestimmten Staat auszuführen (sog. Waffenembargo). Ziel von Embargomaßnahmen ist es politischen Druck auf die vom Embargo betroffenen Beteiligten auszuüben, um diese zu einem bestimmten Handeln oder Unterlassen zu bewegen.
S+P Seminare bieten dir eine fundierte Ausbildung rund um die Themen Kapital- und Zahlungsverkehr, Embargos sowie die neuen Sanktionsdurchsetzungsgesetze (SanktDG).
Wir vermitteln dir das notwendige Know-how, um in diesem komplexen Bereich erfolgreich zu sein. Mit den S+P Seminaren bist du immer auf dem neuesten Stand der Compliance-Pflichten. Aufgrund der ständig wechselnden Rechtslage ist es wichtig, sich regelmäßig über die neusten Entwicklungen zu informieren.
Bei den S+P Seminaren erhältst du umfassende Informationen und kannst dich sofort auf die neuen Herausforderungen einstellen.
S+P Lounge: der Schlüssel zum Erfolg
Lerne jetzt die neuesten Trends und Techniken mit S+P Seminare kennen.
❇️ Sofortige Weiterbildung
Mit der S+P Lounge hast du sofort Zugang zu hochwertigen Lernmaterialien und kannst mit deiner Weiterbildung beginnen.
❇️ E-Learning als Warm Up für den Seminartag
Lerne effektiv mit S+P Lounge – das E-Learning Warm Up. Das im Seminarpreis includierte E-Learning ist eine großartige Möglichkeit, sich auf das gebuchte Seminar vorzubereiten.
❇️ Hochwertiges Lernmaterial
Du erhältst Zugang zu einer Vielzahl an hochwertigen Lernmaterialien, die dich bei deiner Weiterbildung unterstützen.
❇️ Einfacher Zugang
Du kannst dich einfach und schnell in die S+P Lounge einloggen und sofort mit dem Lernen beginnen.